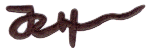 |
||||||||||
|
|
||||||||||
 |
|
Keith Jarrett Audio-CD
Noch keine 18, hatte ich mein Mutterhaus verlassen und ein Zimmer in meiner ersten Wohngemeinschaft bezogen. An der Wand einer Mitbewohnerin hing ein Poster von Virginia Woolf, vom Plattenteller des Wohnungsältesten dröhnten die Rolling Stones mit »I can’t get no satisfaction« und Pink Floyds damalige Neuerscheinung »The Wall«, Yukka-Palmen zierten neben »Elefantenohren« die Fensterbänke, während der runde dunkel gebeizte Holz-Tisch in der Küche als demonstrative Ablage für Marx’ »Lohnarbeit und Kapital«, Dosenbier und Knoblauchpresse diente. Die Reifeprüfung in Reichweite, lebten wir ein Dasein zwischen Rebellion und Rollenspiel, Anarchie und politisch versteckt kalkulierter Kultivierung. Unsere jungen engagiert-chaotischen 68er-Lehrer trafen wir beim Verteilen von Flugblättern in Plauderstimmung auf dem Bremer Marktplatz zur 1.-Mai-Kundgebung, gelbe Buttons mit roten Sonnen galten als Erkennungszeichen unserer Zugehörigkeit: Das »Köln Concert« erklang in Cafés und Kneipen wie eine akustische Tapete. Noch heute spüre ich meinen Zwiespalt beim Betreten der klavier-beschallten Räume. Ein mächtiger Hall-Schwall durchströmte die vorgefundene Atmosphäre von Harmonie und Eintracht zwischen den Anwesenden, die einander fremd waren. Klingender Friede bedeckte die Tiefen des Ungehörten. Himmel und Hölle? Das kleine vegetarische Restaurant »Armer Teufel« in der Bremer Neustadt schien nur eine Platte in seinem Repertoire zu haben: weißes Cover, über die Tasten eines Flügels gebeugter Kopf, erschöpft und ergeben wie eine welkende Blume ihre Blüte zur Erde neigt, um einen Tropfen Wasser bittend. »Armer Teufel« – ein gefallener Engel betet zu Gott: Stolz war ich, nun lieg ich nieder. Sehnsucht weint aus meinen Gliedern, singen meine Tränen Lieder. Eile, heile Welt. Umgarne die Schmerzen der Trauernden. Zu tief, das Loch in der Wunde. Zu groß, die Einsamkeit in der Stille ohne Hülle. Die Klänge der Geborgenheit als Kleid für zermürbte Seelen, Kinder ohne Recht, sie selbst zu sein, ohne Schein und Zwang zu funktionieren. Die Heimat suchend. In sich selbst. Und doch flüchtend. In die Welt. Das Selbst ist klein, die Welt ist groß. Verspricht so viel, und hält doch nichts davon. Kein Halt in der Welt ohne Selbst, das sich mag, wie es ist: klein, aber mein. Für sich allein. Einfach sein. Jutta Riedel-Henck, 30. April – 1. Mai 2007
Links Peter Schulze im Gespräch mit Manfred Eicher (ECM)
Johann Sengstschmid Hit Squad Audio-CD
Ungewöhnlich – das Cover, der Titel, die grafische Gestaltung des Booklets. Ungewöhnlich in dem uns allen gewöhnlich erscheinenden Format digital erzeugter Medienpäckchen, klein, kompakt, praktisch in der Handhabung: CD in transparenter Jewel-Box. Geübt der Griff mit linker Hand die Box zu öffnen, das quadratische Heftchen mit der rechten aus der Klammerung zu ziehen. Beim ersten Blättern neugierigen Blickes durch die Seiten huschend, habe ich Mühe, die schwarzen Lettern zu entziffern. Der malerische Hintergrund drängt sich in den Vordergrund, schluckt an schattigen Stellen ganze Textpassagen, die ich lesen möchte auf der Suche nach einem Wink, was mich erwarten möge an rosettenform- und farben-inspirierten Klängen. Das Druckwerk zur Seite legend, schiebe ich die CD in das obere Fach meines PCs, öffne den Windows Media Player mit einem Mausklick und starte den 1. Track. Die Tür zur Klangwelt des Johann Sengstschmid öffnet sich in majestätischer Höflichkeit, ohne zu zögern trete ich ein. Gerade reiche ich dem Klavier-Portier die Hand, leitet mich das gastfreundliche Fagott in die Empfangshalle des »Sesam öffne dich«. Ich ergebe mich dem Hörerlebnis. Zu lesen brauche ich nicht, was der Entstehung dieser Komposition zu Grunde liegt. Der Klang ergreift meine Aufmerksamkeit. Nach dem Hören des ersten Satzes halte ich für einen Moment inne, gehe zum Eingang und schaue auf das Türschild: Johann Sengstschmid Kirchensonate für Violine, Fagott und Klavier, op. 50 1. Praeludium: Lobet Gott, ihr frommen Christen (07:00) Beim Erraten dieses Titels hätte ich den letzten Platz belegt. Mir war, als sei ich für eine lange kurze Weile durch ein neues Reich gewandelt, einem Märchenland auf Erden, geschritten durch ein Tor der Zeit wie Harry Potter im »Stein der Weisen« von einem magischen Strudel in seine Zauberwelt gesogen wird, mysteriös der Wandel, vertraut das Gefühl von Heimat beim Erkunden der neuen alten Stadt im Anderswo. Das Ohr dicht an den Saiten des Konzertflügels der Firma Yamaha, erinnern die Klänge kaum an die für Kirchen typischen sakralen Hallräume. Von der Aufnahmetechnik abstrahierend, suche ich nach Gleichnissen zwischen Komposition und Titel: Präludium. Die Eröffnung war gelungen, die Einladung zur Meditation unmöglich abzulehnen. Bereit zum Träumen, Bilder aus Tausendundeiner Nacht vor dem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen, präsentiert der Klang-Konditor strahlenden Blickes seinen prachtvollen Nachtisch, Wunderkerzen sprühen Funken, das hörbare Kunstwerk entpuppt sich als flambierte Eistorte, die unter den Flammen der Aufmerksamkeit zu schmilzen beginnt, noch einmal zu schwelgen in den süßen Erinnerungen an das seltsame Märchen im königlichen Morgenland mit seinen kleinen bunten Türmen zwischen Wäldern und Hügeln. Gerade will ich fragen: »War es wirklich so?« Da schwingt das Fagott seinen Flügel und singt: »Natürlich! Wie kannst du zweifeln?« »Deo gratias!« Jutta Riedel-Henck, 2./3. Mai 2007
CD-Inhalt 01-03 KIRCHENSONATE für Violine, Fagott und Klavier, op. 50 Hintergründe, Pressestimmen und weitere Informationen gibt es hier.
Der Komponist Johann Sengstschmid, geb. am 16. Juli 1936 in Steinakirchen am Forst, Niederösterreich, lehrte 1987 bis 1997 an der Grazer Musikhochschule und komponierte bisher über 50 Werke der Klangreihenmusik, überwiegend Über seine künstlerischen Intentionen schrieb Sengstschmid: »Leitschnur meines Schaffens ist der Grundsatz Mozarts, gute Musik müsse sowohl den Normalhörer aus dem Volk ansprechen als auch vor Experten bestehen können. Daher bekenne ich mich in meinen Klangreihenkompositionen zu einer ohrenfreundlichen Akkordwelt: Josef Matthias Hauers (1883-1959) getrübt-konsonante bzw. mild-dissonante Zwölftonharmonik baute mein Lehrer Othmar Steinbauer (1895-1962) zur Klangreihenlehre – einer zwölftönigen Satzlehre im Rang von Kontrapunkt und Harmonielehre – aus, und ich trug durch einige Entdeckungen – hier seien etwa die 1962 von mir gefundenen Prinzipien der Parallelen Klangreihen zu nennen – zu deren Weiterentwicklung bei.« Weitere Angaben (inkl. Fotos) finden sich im Internet unter www.musiker.at/sengstschmidjohann sowie www.klangreihenmusik.at.
György Kurtág Audio-CD
Nicht selten rühmt die Menschheit jene Werke, vor deren Wahrheit sie sich fürchtet. In der Schule machte ich um die Werke Franz Kafkas einen Bogen. Damals hielt ich mich für faul, heute finde ich meine jugendliche Abwehr konsequent. Der Komponist György Kurtág, geb. am 19. Februar 1926 in Lugoj im heutigen Rumänien, war Anfang 30, als sein Interesse für Kafka durch »Die Verwandlung« geweckt wurde.
»[...] daß mir keine ruhige Sekunde geschenkt ist, nichts ist mir geschenkt, alles muß erworben werden, nicht nur die Gegenwart und Zukunft, auch noch die Vergangenheit, etwas das doch jeder Mensch vielleicht mitbekommen hat, auch das muß erworben werden, das ist vielleicht die schwerste Arbeit, dreht sich die Erde nach rechts – ich weiß nicht, ob sie das tut – müßte ich mich nach links drehn, um die Vergangenheit nachzuholen. Nun habe ich aber zu allen diesen Verpflichtungen nicht die geringste Kraft, ich kann nicht die Welt auf meinen Schultern tragen, ich ertrage dort kaum meinen Winterrock. Diese Kraftlosigkeit ist übrigens nicht etwas unbedingt zu beklagendes; welche Kräfte würden für diese Aufgaben hinreichen! Jeder Versuch, hier mit eigenen Kräften durchkommen zu wollen, ist Irrsinn und wird mit Irrsinn gelohnt. Darum ist es unmöglich „damit zu kommen”, wie Du schreibst. Ich kann aus Eigenem nicht den Weg gehn, den ich gehen will, ja ich kann ihn nicht einmal gehn wollen, ich kann nur still sein, ich kann nichts anderes wollen, ich will auch nichts anderes. Es ist etwa so, wie wenn jemand vor jedem einzelnen Spaziergang nicht nur sich waschen, kämmen u.s.w. müßte – schon das ist ja mühselig genug –, sondern auch noch, da ihm vor jedem Spaziergang alles Notwendige immer wieder fehlt, auch noch das Kleid nähn, die Stiefel zusammenschustern, den Hut fabricieren, den Stock zurechtschneiden u.s.w. Natürlich kann er das alles nicht gut machen, es hält vielleicht paar Gassen lang, aber auf dem Graben zum Beispiel fällt plötzlich alles auseinander und er steht nackt da mit Fetzen und Bruchstücken. Diese Qual nun, auf den Altstädter Ring zurückzulaufen! Und am Ende stößt er noch in der Eisengasse auf einen Volkshaufen, welcher auf Juden Jagd macht.
Keine ruhige Sekunde. Unfähig, in der Realität Wahrgenommenes auszublenden, zu filtern und sortieren gemäß seinem Bedürfnis nach Ruhe und Abgrenzung, bleibt die Bitte um Rücksichtnahme auf seine empfindsame Konstitution im geschriebenen Wort gefangen wie ein Geist in der geschlossenen Flasche. Kafka schrei(b)t schweigend:
»Großer Lärm
»Gerade an diesem Abend – Gregor erinnerte sich nicht, während der ganzen Zeit die Violine gehört zu haben – ertönte sie von der Küche her. Die Zimmerherren hatten schon ihr Nachtmahl beendet, der mittlere hatte eine Zeitung hervorgezogen, den zwei anderen je ein Blatt gegeben, und nun lasen sie zurückgelehnt und rauchten. Als die Violine zu spielen begann, wurden sie aufmerksam, erhoben sich und gingen auf den Fußspitzen zur Vorzimmertür, in der sie aneinandergedrängt stehen blieben.« (Franz Kafka: Die Verwandlung)
»Die Wohnungstüre wird aufgeklinkt und lärmt, wie aus katarrhalischem Hals, öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer Frauenstimme …« »Als die Violine zu spielen begann, wurden sie aufmerksam ...«
György Kurtág »Dass sich die Kafka-Fragmente allein auf eine Singstimme und eine Violine beschränken ist, wie der Komponist selbst bekundet, eher zufällig geschehen. Er war 1985 mit der Komposition eines, allerdings bis heute unvollendeten, Klavierkonzertes beschäftigt, hatte es aber wegen eines Bartók-Seminars in Szombathely beiseite legen müssen. Nun begann er fast nebenbei die Musik zu ein paar der ausgewählten Textfragmente zu skizzieren. Zunächst nur provisorisch, denn die Kombination von Sopran und Violine hätte sich in diesem Stadium der Komposition durchaus noch erweitern lassen können. Nach und nach erwies sich für ihn dann das provisorisch Gemeinte als endgültig; […].
Das erste Fragment erklingt »Die Guten gehn im gleichen Schritt.« … Ich höre die Violine in großen Sekunden in meinen Hörraum schreiten, gemächlich, gemäßigt. Im selben Rhythmus fügt sich die Sopranstimme im Abstand einer Quinte über die Schritte, »Die Guten gehn«, um ausgerechnet beim »gehn« auf dem Ton stehen zu bleiben. Während die Violine unbeirrbar weiter schreitet, schleicht die Singstimme »im gleichen Schritt« die Töne hinauszögernd aus der Reihe, um »die andern […] die Tänze der Zeit« um »die Guten« tanzen zu lassen, »ohne von ihnen zu wissen«. 74 Sekunden genügen dem Komponisten zur Veranschaulichung elementarer Gestaltungsmittel. Mir kommt das Werk eines Zeitgenossen Franz Kafkas in den Sinn: »Die Geschichte vom Soldaten« von Igor Strawinsky, geb. im Juni 1882 in Oranienbaum bei Petersburg. Auf dem Weg in sein Heimatdorf begegnet der Soldat Joseph dem Teufel und tauscht seine Geige gegen ein Zauberbuch, das ihm Reichtum und Anerkennung verspricht. Zu Hause angekommen, ist die Braut verheiratet, seine Mutter und Freunde erkennen ihn nicht wieder. Pastorale: Traurig klagt die Klarinette über dem rhythmisch schwankenden, im Ganztonschritt pendelnden Horn (?).
Teil I, Fragment 19 Die Sopranistin Juliane Banse schenkt dem empfindsamen Schriftsteller ihre bis an die Grenzen des Möglichen reichende Stimmgewalt. Aus dem stillen Wasser schießen Töne wie sprühende Funken, als säße in den Tiefen des Springbrunnens ein messerwetzender Geist, die Oberflächenspannung der Seele zu sprengen, um nach erfolgter Metamorphose (Verwandlung) von der Raupe (Schlange) zum erwachsenen Insekt (Käfer) die schützende Puppe (Gefängnis) zu verlassen. 23 Sekunden absoluter Stille vergehen bis zum Beginn des nächsten Fragments. Zeit der Besinnung.
»Es klingt verdreht, aber es ist so. Auch ist es vielleicht nicht eigentlich Liebe, wenn ich sage, daß du mir das Liebste bist; Liebe ist, daß Du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle.«
Gnadenlos scharf blitzt das Messer aus den beißenden Höhen der präzise zielenden Frauenstimme, während András Keller die Violine unnachgiebig in der Wunde wühlen lässt. György Kurtág lässt den Schmerzen keine Chance, unerhört zu bleiben, begleitet von nagenden Selbstzweifeln und Ängsten vor der Offenbarung verdrängter Gefühle: Dass er den seelischen Ausdruck der »kleinen Jungen« Franz und György an eine durch den gesamten Zyklus souverän leitende Frauenstimme delegiert, lässt das Männliche entgegen verbreiteter Klischees leise, schwach und schutzbedürftig erscheinen. Teil III, Fragment 24:
Teil III, Fragment 22: Maria Magdalena, die Gefährtin Jesu, wurde einer Auslegung Papst Gregor I. zufolge mit der namenlosen Sünderin, einer Prostituierten, welche Jesus die Füße salbte, gleichgesetzt. Ein Missverständnis, das bis in die Gegenwart hinein Bestand hat.
Teil I, Fragment 14: Wilhelm Reich deutete das von Sigmund Freud als moralische Instanz definierte »Über-Ich« als »funktionell identisch« mit dem psychophysiologisch verstandenen »Charakterpanzer«. In »Christusmord«, seinem wohl wichtigsten Werk, schreibt der Psychoanalytiker: »Christus weiß, dass er sterben muss, weil in den Herzen und Gedanken der Menschen kein Platz für ihn ist. Sie begreifen einfach nicht, wovon er redet. Er spricht nicht in rätselhaften Gleichnissen. Er äußert sich in klaren Worten über kristallklare Zusammenhänge. Aber sie haben kein Ohr für diese Worte. Sie werden seine Worte vielmehr falsch deuten, und darum muss er sterben.
So wohl durchdacht, hingabevoll komponiert und virtuos zum Klingen gebracht die aus Kafkas Schriften entnommenen Fragmente mir in dieser gewissenhaft produzierten Aufnahme begegnen, vermag ich nicht zu leugnen, dass die Strenge der Durchführung mir wie ein Sieg des Verstandes über ein verzweifelt nach Befreiung rufendes Herz erscheint. Die Messlatte Kurtágs ist extrem hoch gesteckt, als sei er wie viele seiner Geschlechtsgenossen gefangen in den Ansprüchen eines sich selbst züchtigenden Perfektionismus’, der sich weder Schwächen noch Fehler verzeiht.
»The ECM recording of György Kurtág’s „Kafka-Fragmente” has already won a number of awards, including the 2006 Modern Music Prize of the Japanese Record Academy Awards and the 2007 MIDEM Classical Award as Best Contemporary Music Album. The recording also collected the quarterly prize of the German Records Critics (Preis der Deutschen Schallplattenkritik Bestenliste 2/2006). The disc was widely reviewed, and widely praised, all around the world... Now comes a new prize. The „Kafka-Fragmente” has won the Belgian Prix Caecilia, awarded by the Union de la Presse Musicale Belge, as best chamber music album of the last year....«
Ich wünsche mir, dass jene, die mit Preisen ihre Anerkennung kundtun, sich der tiefen menschlichen Not bewusst sind, aus welcher Wort und Ton geboren wurden! Nur mit dem Herzen können wir be-greifen, was der Mensch an Irrtümern vollbrachte, um aus ihnen zu lernen, statt im Erbe der Vergangenheit endlos variierte Wiederholungsschleifen – Lorbeerkränze und Dornenkronen – zu binden. »Niemand singt so rein als die, welche in der tiefsten Hölle sind; was wir für den Gesang der Engel halten, ist ihr Gesang.« Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Der Himmel hängt nicht voller Geigen. Soli Deo Gloria – Gott alleine die Ehre! Jutta Riedel-Henck, 11.-17. Mai 2007
Links ECM Records, Hintergrund zur CD Kafka-Fragmente Wikipedia: Der Komponist György Kurtág DIE ZEIT 23.02.2006 Nr.9 Im Vergleich die Auswahl der Kafka-Fragmente II (1993) von Xaver Paul Thoma (geb. 1953), eines Komponisten der Kurtág nachfolgenden jüngeren Generation, der die Worte des Schriftstellers für Bariton-Stimme mit Klavierbegleitung vertonte.
Iva Bittová ECM 1985
Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für meinen Vater, der in Prag geboren und aufgewachsen ist, klickte ich mich durch die Seiten der Internet-Auktionsplattform Ebay und wurde rasch fündig. Für wenige Euro erhielt ich einen Satz volkstümlicher Liedersammlungen aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Mit meiner Gitarre auf dem Schoß stimmte ich die ein und andere Melodie an. Ein Lied gefiel mir auf Anhieb und schien in einen Zyklus von Schlafliedern zu passen, den ich gerade für eine CD-Produktion zusammenstellte. Per E-Mail wurde mein Vater beauftragt, den Text zu übersetzen. Und tatsächlich handelte es sich um ein Schlaflied. So einfach, direkt und unkompliziert kann Musik wirken. Zeitsprung. Wieder klickend. Dieses Mal durch die Internetseiten des Münchner Plattenlabels ECM. Ein dunkeltürkisfarbenes fein strukturiertes Cover trifft meinen Geschmack. Die großen schwarzen handgeschriebenen Blockbuchstaben lassen das Gesamtbild geheimnisvoll erscheinen. Kennwort: MATER. Der lateinischen Sprache nur mit einem Lexikon schwach mächtig, assoziiere ich kindlich spontan den Marterpfahl der Indianer. Sigmund Freud hätte seine Freude gehabt. Doch, mein Freund, sei stille. Erst kürzlich las ich von dir und deiner Mutter, was du zu Lebzeiten verschwiegen hast. Verstand, nimm mich bei der Hand! Vergiss die subjektiven Spielereien und lies mit klarem Blick, was sich verbirgt in den Tiefen der kleinen glänzenden Scheibe, die zu entschlüsseln du ohne Technik niemals fähig sein wirst. Google hilf! Auf Google ist Verlass: www.mater-musik.de Klick. Mein Bildschirm färbt sich. Wunderschön! Kaum satt sehen kann ich mich an diesem tief leuchtenden Farbton. Falls Sie sich jetzt fragen, ob ich überhaupt kompetent bin, um eine objektive Rezension mit wissenschaftlichem Hintergrund zu verfassen, brauchen Sie nicht auf die Antwort zu warten: Nein! Ich habe zwar studiert und irgendwo im Karton eine Urkunde liegen, die mir erlaubt, die ersten beiden Buchstaben des hier besprochenen CD-Projektes hinter meinen Namen zu setzen … doch glücklich schien der Herr Professor nicht mit mir beim Händeschütteln nach erfolgter Prüfung. Was auf Gegenseitigkeit beruhte. Musikwissenschaft: Musik im Kopf, das Herz in der Hand. Im musikwissenschaftlichen Institut übten Frauen den Beruf der Sekretärin aus und betreuten die Bibliothek. Die Professoren trugen Anzüge, aber keine Röcke. Vladimír Godár, so lese ich auf der Website des Mater-Musik-Projektes, ist ein Kollege. Doch während ich nach mehrmaligen Leseanläufen den »Doktor Faustus« von Thomas Mann genervt aus den Händen legte, erklärt der Komponist und Musikologe die Entwicklung seiner »Idee einer Art musikalischer Archäologie« als von Thomas Mann beeinflusst, welcher im 25. Kapitel seines Romans den Teufel sagen lässt: »Jeder Klang trägt das Ganze, auch die ganze Geschichte in sich.« Das mittelalterliche Gedicht »Stabat Mater« wurde einer privaten Website zufolge von etwa 600 Komponisten vertont. Bis in die Gegenwart hinein verfolgt das Bild des Gekreuzigten seine Nachgeborenen, um Gefühle zu wecken zwischen Leid und Trauer, aber auch Dankbarkeit im Angesicht des gewaltsamen Todes, dem eigenen (Über-) Leben gewahr zu werden. Ich schaue mir die Liste der Komponisten an und finde meine Vermutung bestätigt, dass es überwiegend Männer waren, welche den Singenden ihre musikalische Auslegung der Klageworte um Marias Schmerzen »in den Mund komponierten«. Niemand wird je wissen, was die Mutter Jesu wirklich dachte, fühlte, sagte, tat oder gar sang. Die Kantate »Mater« von Vladimír Godár setzt sich aus sechs eigenständigen Werken zusammen.
»Alle Stücke – entstanden 1997 - 2005 – widmen sich Aspekten des menschlichen Lebenskreislaufs. Lateinische und slowakische Textvorlagen, Jiddisches und Christliches, sakrale und weltliche Gesänge verbinden sich unter dem überkonfessionellen Thema „Frau“ respektive „Mutter“: als Beschützende, Tröstende, Trauernde und als Himmelskönigin. Das in slowakischer Sprache gesungene Stabat Mater, wurde dagegen unmittelbar von Ivá Bittovás Kunst angeregt: „Von allen geistlichen Texten hat mich das Stabat Mater immer am meisten angezogen“, sagt Godár. „Als ich die Vertonung Arvo Pärts zu hören begann, erschien mir diese derart perfekt, dass ich eine neue Version zunächst für redundant hielt. Erst als ich Ivá kennen lernte, ihre musikalische Intuition, Energie und Disziplin, da wusste ich, dass ich ein Stabat Mater für sie würde schreiben können. Ihr Gesang ist rein und voller Emotion und ihre Aussprache exzellent.“«
Die Gefährdung der Bindung zwischen Mutter und Kind zieht sich als Stimmung durch den gesamten Zyklus. Sinnt in dem jiddischen »Maykomashamalon« die Sängerin über die Bedeutung des Regens nach, dessen Tropfen am Fenster herunterrinnen wie jemandes Weinen, beginnt das Magnificat mit einem bedrohlich wirkenden tief gestrichenen Basston, auf dem das Gebet Marias schwebt wie eine Gewitter-Wolke, aus der in der zweiten Hälfte während der räumlichen Entfaltung des »Magnificat« durch den erhaben klingenden (Engels-) Chor die Ruhe aufschreckende Violinen-Blitze schießen. In den Schlafliedern fällt eine Katze aus der Wohnung, folgt nach dem beruhigenden Hushaby (engl. Übersetzung) die für jedes Kind beängstigende Aussage, dass die Mutter nicht zu Hause sei, im nächsten werden Schafe von Hunden gefressen, und wieder folgt dem »Hushaby, I will rock you«: Wenn du eingeschlafen bist, werde ich dich verlassen. In zwei »Lullabies« wird das Geschlecht des Kindes benannt: boy, in einem anderen heißt es Johnny. Wie im folgenden »Ecce Puer« auf ein Gedicht von James Joyce steht der Sohn im Mittelpunkt des Wort- und Klang-Geschehens. Der irische Dichter schrieb diese Zeilen 1932 anlässlich der Geburt seines Enkels und bald nach dem Tod seines Vaters. Immer wieder Trauer um die Vergänglichkeit des Lebens nach dessen Geburt … Momente des kleinen Friedens getrübt vom großen Unglück, das im Schweben der Klänge unausweichlich schicksalhaft erscheint. Dem »Stabat Mater« um die Schmerzen der grausamen Hinrichtung des Sohnes folgt das »Regina Coeli«. Betroffen von dem zuvor besungenen Kummer und Schmerz, vermag ich den Überschwang nicht zu teilen, der in höchsten Tönen durch den Gott preisenden Chor-Gesang im Hallelujah der Solistin Iva Bittová mündet. Fragend bleibe ich zurück und suche nach dem Sinn des r, das ich beim ersten Lesen des Titels aus meinem Unterbewusstsein fischte. Es wandert durch den Zyklus wie eine Schlinge im schwingenden Faden, von der nur Bruchstücke ins Bewusstsein des Hörers dringen. Am Ende erklingt noch einmal der nachdenkliche Gesang »Maykomashamalon« um die rinnenden Tropfen an der Fensterscheibe, im Vergleich zum Anfang mit größerer Hör-Distanz zur Stimme, die sich im Raumhall zu verlieren scheint. »Jeder Klang trägt das Ganze, auch die ganze Geschichte in sich.« Das Ganze – haben wir es je ergründet? »Mater« von Vladimír Godár ist trotz Integration volkstümlicher Lieder und Texte ein Kunstwerk. Der Hörer öffnet die Tür zur Form und schließt sie nach Verklingen des letzten Tones wie nach einem sonntäglichen Kirchenbesuch. Es bleibt die Erinnerung an das Bad in seinen Klängen, welches Spuren im Gedächtnis der Seele hinterlässt, die von neuen Klängen überspült in Vergessenheit geraten. Im Meer des All(e)s gibt es viel zu schöpfen. Wir selbst schreiben unsere Geschichte. Dass manche Bilder der Vergangenheit über viele tausend Jahre hinweg bestehen und im Gegenwärtigen zum Rückwärtsdenken animieren, mag Ausdruck sein für die oberflächliche Lebensweise des Menschen, der seine Sinne unreflektiert dem materialistischen Fortschritt widmet und dabei den Kontakt zu seinen spirituellen Wurzeln verliert. »Materie« aus dem Lateinischen »materia« ist eine Ableitung des Stammwortes »mater«. Das Bild des Sohnes, dessen Körper vor den entsetzten Blicken seiner irdischen Mutter stirbt, um als Sohn der Himmelskönigin (Mutter Gottes) wieder aufzuerstehen, ließe sich interpretieren als Gleichnis für den Weg des von der Mutter abhängigen Sohnes zum eigenständigen Individuum, welches sich aus der Obhut der Mutter (Körper) durch Hinwendung zum Vater (Geist) löst, um seine Seele nach erfolgter Abnabelung (Auferstehung) frei zu entfalten (Himmelfahrt). Ein Blick über den Rand gängiger Kunstschubladen in die Welt der Popularmusik offenbart uns den herrschenden Geist der Zeit: »Frauen regier’n die Welt«, sang Roger Cicero swingend am 12. Mai als diesjährigen Beitrag Deutschlands für den Eurovision Song Contest 2007 in Helsinki, während »Männer«-Sänger Herbert Grönemeyer in seinem unnachahmlich eigenmächtigen Rhythmus im Februar mit »Ein Stück vom Himmel« die Spitze der deutschen Charts erklomm. Ich entwickelte bereits 1986 den Plan, meine Magisterprüfung der Zusammenführung von Sinnlichkeit und Ratio zu widmen. Wenn der Klang das Ganze in sich trägt, muss der Mensch ihm in seiner Ein-fachheit begegnen, um sich nicht künstlich selbst zu teilen. Die daraus resultierende Individualität des Menschen in jedem Moment seines Daseins widerstrebt jedoch dem Gedanken wissenschaftlicher Verallgemeinerung und damit allen darauf bauenden Ideologien vermeintlicher Werte zwischen »Kunst« und »Kitsch«, »E-« und »U-Musik«. Nur in abgeschlossenen Gedankenwelten fern des sinnlich unbegrenzten Empfindens kann ich mich über das Ganze stellen in dem Glauben, göttliche Macht zu besitzen. Das, so scheint mir, ist die Spezialität des »Teufels«, dem Thomas Mann ein Stück Lebenszeit beim Schreiben seines umfangreichen Romans »Dr. Faustus« widmete. Der ständigen Rechtfertigungen überdrüssig, widme ich mich den Klängen lieber ohne Umwege denn als nach Allwissen strebende Gedankenakrobatin. Jutta Riedel-Henck, 19.-23. Mai 2007
Links ECM Records, Hintergrund zur CD Mater
The Hillard Ensemble ECM 1930
»Lamentate« für Piano und Orchester aus dem Jahre 2002 ist eine Auftragskomposition, inspiriert von der Skulptur »Marsyas« des am 12. März 1954 in Indien geborenen und seit 1972 in London lebenden Bildhauers Anish Kapoor. Die erste Titelformulierung »LamenTate« spielt auf den Ort der Uraufführung an: Londons Galerie Tate Modern, einer ehemaligen Turbinenhalle.
»Als ich den „Marsyas“ von Anish Kapoor bei der Ausstellungseröffnung im Oktober 2002 in der Turbinenhalle der Tate Modern in London zum ersten Mal sah, war der Eindruck gewaltig. Mein erster Gedanke war: Ich als Lebendiger stehe vor meinem eigenen Körper und bin tot – wie in einer Zeitverschiebung, in der Zukunft und Gegenwart gleichzeitig stattfinden. Plötzlich sah ich mich in eine Position versetzt, aus der mein Leben in einem anderen Licht erschien. In diesem Moment hatte ich das starke Empfinden, noch nicht reif zu sein für das Sterben. Und die Frage tauchte auf, was ich in der mir verbleibenden Zeit noch bewältigen könnte.«
Der am 11. September 1935 in Estland geborene Komponist war zu diesem Zeitpunkt 67 Jahre alt. Ein Jahr zuvor wurde das Datum seines Geburtstages mit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 in den USA unwiderruflich belastet. Zwei architektonische Mammutbauten kamen dabei zum Einsturz, die Größe und Macht symbolisierten, mit ihrer Zerstörung ein Bild des Grauens hinterließen und den Menschen zwangen, seine in Stein bzw. Beton gehauenen Größenfantasien als das zu erkennen, was sie waren: vergänglich wie all jene, die bei dieser Katastrophe zu Tode kamen. Geblieben sind die von diesem Ereignis geprägten Überlebenden, nicht wenige traumatisiert bis ans Ende ihres irdischen Daseins. Der Künstler Anish Kapoor war mir ebenso wenig bekannt wie die von ihm geschaffene Monumentalskulptur »Marsyas«. Wieder einmal führte mich »Google« zu den nötigen Informationen – und Bildern. Anders als Arvo Pärt in seiner realen Begegnung mit dem Kunstwerk als Besucher der Ausstellung reagierte ich beim Anblick der Fotos distanziert und abgeneigt. In der griechisch-römischen Sage ist Marsyas ein halbgöttliches Wesen (Satyr). Er findet die von Athene erfundene Flöte (Aulos), welche diese fortwirft, nachdem sie im Spiegel des Wassers erkennt, wie das Spielen ihr Gesicht entstellt. Marsyas erlernt das Spielen der Flöte mit großem Eifer und fordert Apollon zu einem Wettstreit heraus. Der von den Musen zum Sieger ernannte Gott Apollon hängt Marsyas zur Strafe an einen Baum und zieht ihm bei lebendigem Leib die Haut ab. Anish Kapoor bespannte zwei trichterförmige Arme, die aus einem offenen Korpus herauswachsen, mit rotem PVC, welche eine Brücke zwischen den beiden Teilen der 155 m langen, 23 m breiten und 35 m hohen Turbinenhalle des Tate Modern bildeten.
»Nicht nur der Titel lässt den gehäuteten Körper des Marsyas’ assoziieren: Die Skulptur ist ein mit blutroter Plastikplane bespanntes, spiegelsymmetrisches Gebilde mit drei trichterförmigen Ausgängen. Zwei davon öffnen sich vertikal an den beiden Längsseiten der Halle, jener in der Mitte schwebt horizontal wie eine Glocke über den Besuchern. Von keinem Standort aus lässt sich das Werk übersehen, geschweige denn fotografieren. Es ist nur als Volumen erfahrbar, das den eigenen Körper-Raum neu definiert. Steht man unter einem Trichter im dumpfen Rot, hat man das bedrohliche Gefühl, von einem Organismus aufgesogen zu werden; von den oberen Stockwerken aus dominiert der plastische Effekt.« (Barbara Basting: »Das unwiederholbare Pathos der Moderne«. In: Tages-Anzeiger Zürich, 30.10.2002; S. 61; Internetlink: http://www.xcult.ch/texte/basting/03/newman.html )
Mit dem auffordernden Titel »Lamentate« (Klaget) tue ich mich auch nach mehrmaligem Hören der Komposition schwer. Vielmehr scheint mir aus den Klängen ein dem Diesseits für Momente Entrissener von seinen Reise-Eindrücken zu erzählen. Während bedrohliches Gewittergrollen die irdische Existenz ins Wanken bringt, perlen einzelne Klaviertöne wie erfrischend spritzende Quellwassertropfen von den (Konzert-) Flügeln wegweisender Engel, die zum Licht des himmlischen Paradieses leiten. Statt Klagen höre ich besinnliche Rückblenden mit einem Hauch von Trauer, eines Wesens, das Abschied nimmt vom Gestern, schwebend in einem Zwischenreich vor dem Tor der Zeitlosigkeit, die Erlösung spürbar nahe.
»In diesem Moment hatte ich das starke Empfinden, noch nicht reif zu sein für das Sterben. Und die Frage tauchte auf, was ich in der mir verbleibenden Zeit noch bewältigen könnte.« (Arvo Pärt a.a.O.)
Vielleicht ist es diese Erfahrung zwischen Leben und Tod bzw. Tod und Leben, welche Arvo Pärt durch seine Komposition zu bewältigen sucht, um sich durch die Klänge ins Licht tragen zu lassen und all jene zu trösten, die den Übergang ins »Reich der Toten« fürchten, beeindruckt von den Bildern strafender Götter und ihrer himmlischen Jury, die hinter der Schwelle des Todes mit einem Zeugnis in der Hand Urteile verliest, um dem Verlierer bei lebendigem Leibe die Haut abzuziehen, ihm das ewige Leben zur Hölle zu machen. Die sanften (Engels-) Flügeltöne lösen sich aus dem Gefüge der Angst einflößenden Orchesterklänge wie eine Seele, die dem irdischen (Glaubens-) Kollektiv entfleucht, indem sie das Licht des Grenzenlosen als Heimat erkennt und sich dieser vertrauensvoll zuwendet.
»Lamentate ist Musik für Solo-Klavier und Orchester. In seiner Gestalt kann die Komposition jedoch nicht ganz als klassisches Klavierkonzert bezeichnet werden. Ich habe ein Soloinstrument gewählt, weil es unsere Aufmerksamkeit auf etwas fixiert, das „Eins“ ist. Dieses „Eins“ könnte eine Person sein, es könnte eine Erzählung in Ich-Form sein. Analog zu der Skulptur, die trotz ihrer überwältigenden Größe einen leichten und schwebenden Eindruck hinterlässt, erlaubte mir das Klavier als größtes Instrument, eine Sphäre von Intimität und Wärme zu schaffen, die nicht mehr anonym und abstrakt wirkt.« (Arvo Pärt, a.a.O., S. 4-5.)
Der Solist, der Einzelne, Einsame löst sich aus der hierarchischen Struktur der Gruppe, statt sich von dieser bestätigen zu lassen. Eine musikalische Autobiografie? Monumentale Werke der bildenden Kunst wie »Marsyas« von Anish Kapoor sind gebunden an den Ort ihrer Ausstellung und damit nur einer Minderheit von Reisewilligen und -fähigen vorbehalten, sie aus unmittelbarer Nähe zu betrachten. Eine meiner ersten Assoziationen beim Erblicken des riesigen Schalltrichters führte mich zu einem Maler des Mittelalters: Hieronymus Bosch (um 1450-1516) mit seinem um 1500 entstandenen Gemälde »Der Flug zum Himmel«.
Ich gestehe gerne, dass ich dieses Kunstwerk für sehr viel geeigneter halte, die Klangreise Arvo Pärts »ins rechte Bild zu rücken«. Das der Komposition »Lamentate« vorangestellte Friedensgebet »Da pacem Domine«, ein vierstimmiges A-cappella-Werk, zieht die Aufmerksamkeit des Hörers wie das weiße Licht am Ende des Tunnels in seinen Bann, ohne ihn sinnlich zu überwältigen. Der Flug zum Himmel befreit die Seele von ihren irdischen Belastungen, das weiße Cover der CD gleicht einer Friedensfahne in Zeiten des Krieges. Allein der Titel gibt mir Grund zum Klagen: Lamentate. Mir erscheint das am 7. und 8. Februar 2003 in der Londoner Turbinenhalle Tate Modern uraufgeführte Werk wie eine musikalische Erzählung unter dem Titel »Durch die Nacht zum ewigen Licht« – das ungeachtet irdischer Sünden auch dem Satyr Marsyas ein friedvolles Zuhause schenkt. Jutta Riedel-Henck, 15.-17. Juni 2007
Links ECM Records, Hintergrund zur CD Lamentate Fotos der Skulptur »Marsyas« von Anish Kapoor
© 2007 by Jutta Riedel-Henck
|
| nach oben |


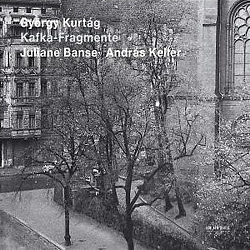
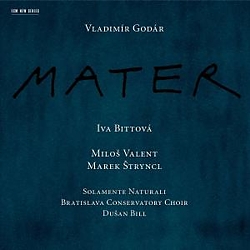 Vladimír Godar
Vladimír Godar
